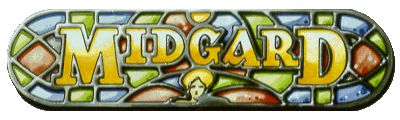Mit der Schnauze in die Milch
Der nachstehende Artikel ist dem (sehr empfehlenswerten) Buch Fundgrube Geschichtevon Harald Parigger (Cornelsen-Verlag, 1996) entnommen. Er sorgt stets für gute Unterhaltung im Geschichtsunterricht. Harald Parigger zieht seine Informationen laut eigener Angabe aus dem Buch Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830–1910 von J. Evans (1990).
Angebrütete Eier in Nudeln, Methanol im Wein, hormongespritztes Fleisch – wer könnte nicht weitere aktuelle Beispiele anführen? Und doch leben und essen wir heute in relativer Sicherheit, verglichen mit Art und Umfang der Lebensmittelverfälschung vor 100 oder 150 Jahren. Denn im 19. Jd. – das zeigen Untersuchungen in Deutschland wie in England – verschlechterten sich Lebensmittel spürbar; nicht dort, wo es Selbstversorgung gab oder Produzenten und Verbraucher in direktem Kontakt standen: Gefährdet waren vor allem die Menschen in den rasch wachsenden industriellen Zentren. Mangelnde Hygiene und eine um sich greifende Lebensmittelverfälschung waren die Ursachen.
In den Großstädten funktionierten die seit alters üblichen Qualitätskontrollen nicht mehr. Die Ideologie des freien Wettbewerbs setzte sie außer Kraft und verhinderte die Entwicklung neuer. Bauern vermarkteten nicht mehr selbst; der Zwischenhandel breitete sich aus. Je mehr aber mitmachten, desto größer waren die Möglichkeiten einer Verfälschung. Der Konkurrenzdruck stieg stark an: 1861 kamen in Deutschland 83 Verbraucher auf einen Einzel- oder Großhändler, 1907 waren es 30. Ende der 70er Jahre sank die Gewinnspanne durch Besteuerung und Einfuhrzölle. Da lag es nahe zu verdünnen und Ersatzstoffe beizumischen oder sich der Möglichkeiten der Chemieindustrie zu bedienen.
An staatlichen Kontrollen fehlte es weitgehend. Zwar gab es – nach einer breiten öffentlichen Diskussion in den Zeitungen – seit 1879 das Reichsnahrungsgesetz, das die „Überwachung des Verkehrs mit Lebens- und Genussmitteln“ vorsah; aber ohne Kontrolleure und Labors zeigte es zunächst wenig Wirkung. Erst seit den 1890er Jahren änderte sich das – sehr allmählich. Seit 1892 gab es beispielsweise in Hamburg ein Hygienisches Institut.
Die Qualität von Lebensmitteln ist eine Frage des Preises, das heißt, Arbeiter und ihre Familien waren von den Verfälschungen am meisten betroffen. Für diese ärmeren Schichten war Brot neben Kartoffeln Hauptnahrungsmittel. Berichten aus den Jahren 1877/78 ist zu entnehmen, dass Mehl durch Beigabe von Schwerspat, Gips, Kreide und anderen Substanzen um 20 bis 30% gestreckt wurde. Oder es wurden Ersatzstoffe wie z.B. Kartoffeln beigemengt. Feuchtes und säuerliches Mehl wurde mit Hilfe von Alaun, Kupfervitriol oder Zinksulfat belebt, „damit es eine weiße Farbe bekam und der Teig sich leichter kneten ließ“ (Berliner Tagblatt 13. September 1877). Über 60% der 1889 in Hamburg gezogenen Butterproben waren eher ein Gemisch aus Margarine und tierischem Fett. Bier wurde vielfach verwässert, Schokolade als Massenprodukt aus Gummiharz und billigem Hammelfett hergestellt. Der Bundesratsbericht von 1878, der auf den Erlass des Reichsnahrungsgesetzes abzielte, konstatierte auch die Verfälschung von Teigwaren. Als Färbemittel bei Kuchen und Gebäck dienten Chromgelb. Kupferoxid, Mirbanessenz (Nitrobenzol) und andere Schadstoffe. Um Eiernudeln die gewünschte gelbe Farbe zu verleihen gab man dem Teig mit Urin vermischte hochgiftige Pikinsäure bei. „Die Werkstätten der Konditoren“, so der Bericht, sind „zu vollständigen Ateliers für eine fast gewerbsmäßige Anwendung von Giften“ geworden. Die ersten wissenschaftlichen Einrichtungen der Lebensmittelkontrolle in den 90er Jahren konnten das schon 1878 erahnte ungeheure Ausmaß der Verfälschungen nur bestätigen.
Eine regelmäßige Fleischbeschau gab es ebenfalls erst seit den 90er Jahren. Auch danach wurden kranke Tiere häufig schwarz geschlachtet und billig verkauft. So wurden Krankheiten wie Milzbrand, Tuberkulose oder gefährliche Infektionen mit Parasiten – wie die Trichinose – auf den Menschen übertragen. Es gab im Deutschen Reich bis 1914 mehrere Fälle von Massenvergiftungen, zum Teil mit Todesfolge, durch verdorbenes Fleisch. Das „Schönen“ mit Farbstoffen war auch bei Metzgern und Fleischverkäufern durchaus verbreitet.
Milch war ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Für Hamburg hat man für 1906 einen täglichen Verbrauch von durchschnittlich 282 000 Litern ermittelt. Den größten Teil brachten Milchhändler mit Hundekarren in die Stadt. Erst 1894 gab es in Hamburg eine Verordnung, die für Milcheimer einen Deckel vorschrieb. Vorher war die Milch Regen, Sonne oder Staub ausgesetzt oder der Hund, der den Karren zog, steckte seine Schnauze hinein. Die Bauern durften die Milch vor dem Verkauf nicht kühlen, weil sich von warmer Milch der Rahm leichter abschöpfen ließ. Anschließend wurde oft gelbe Farbe zugesetzt um ihr das Aussehen von Vollmilch zu verleihen. Das zugefügte Wasser war nicht selten verunreinigt und wimmelte von Krankheitserregern. Im Sommer mischte man Borax und Borsäure bei um ein rasches Schlechtwerden zu verhindern, manche Händler verwendeten Formaldehyd. Pasteurisierung der Milch war kostspielig und setzte sich seit den 90er Jahren nur langsam durch. Eine privat initiierte Untersuchung von 1878 ergab in Hamburg, dass 80% der Milchproben verfälscht waren. 1894 waren es bei der ersten staatlichen Milchüberprüfung 25% der Proben: Man musste seit einiger Zeit mit Kontrollen rechnen!
Die Verfälschungen führten zu zahlreichen Gefahren für Gesundheit und Leben. Kupfersulfat, Chromgelb und andere anorganische Substanzen konnten zum Tod führen. Blei, Kupfer und Arsen lagerten sich im Körper ab und führten zu einer allmählichen Schwächung des Verdauungssystems. Insgesamt beeinträchtigten Verfälschungen den Nährwert. Nicht nur das Beispiel der Milch macht deutlich, dass Säuglinge und Kleinkinder besonders gefährdet waren. Eine amtliche Statistik in Hamburg aus den siebziger und 80er Jahren verzeichnet bei über 60% der Todesfälle von Babys als Ursache Störungen des Verdauungssystems: „Sommer-Brechdurchfall“, Krämpfe, Auszehrung lauteten die „Diagnosen“. An verdorbenes Wasser ist dabei ebenso zu denken wie an verunreinigte und verfälschte Lebensmittel.